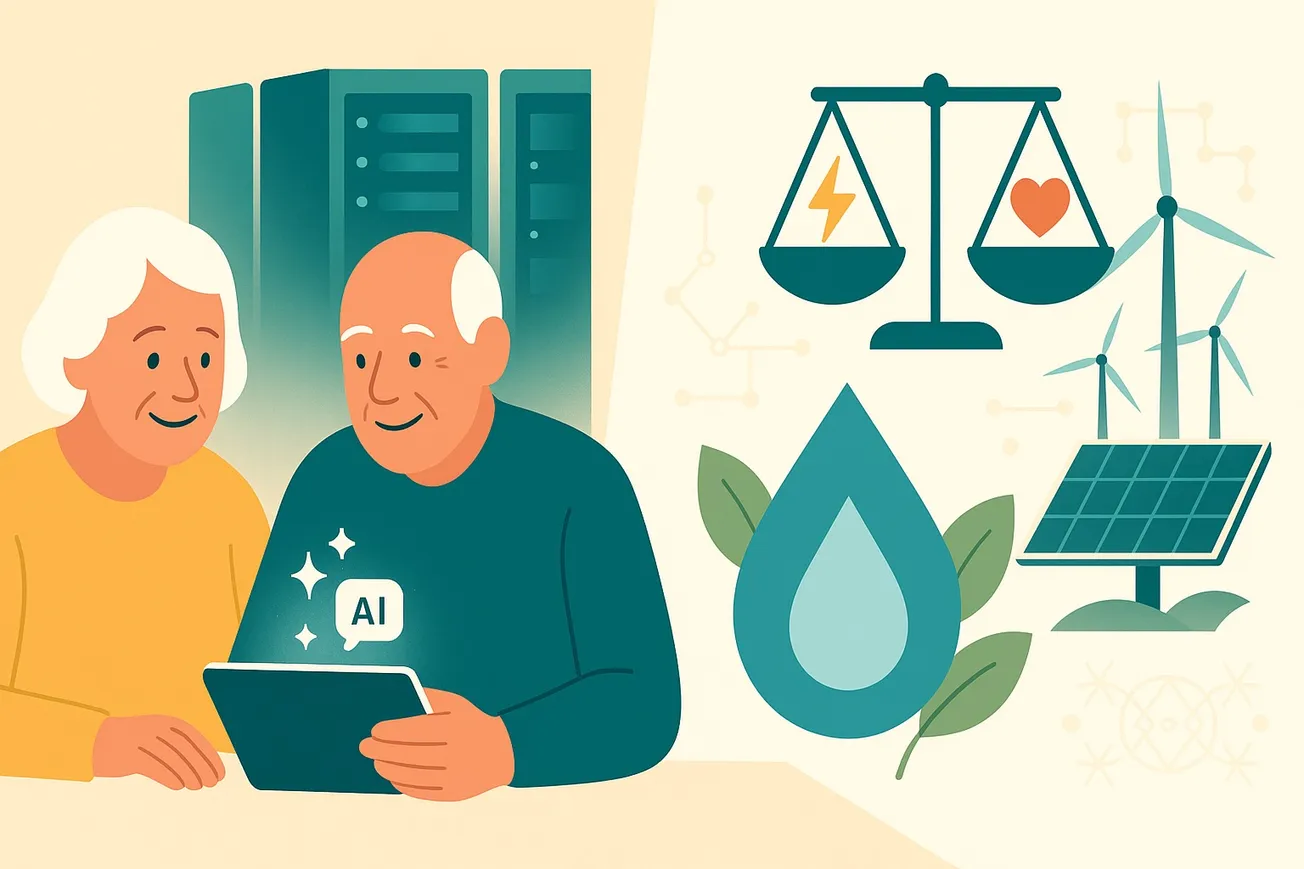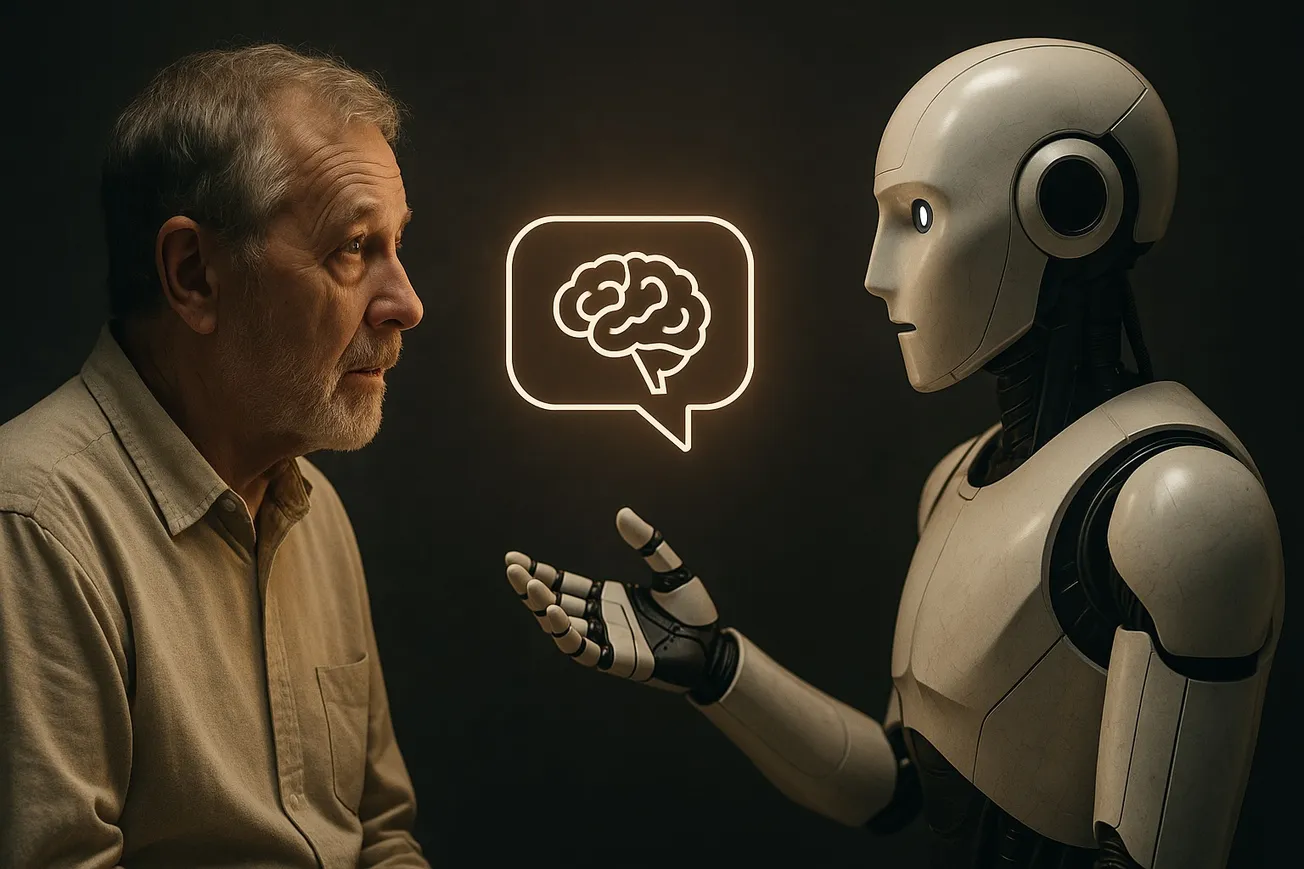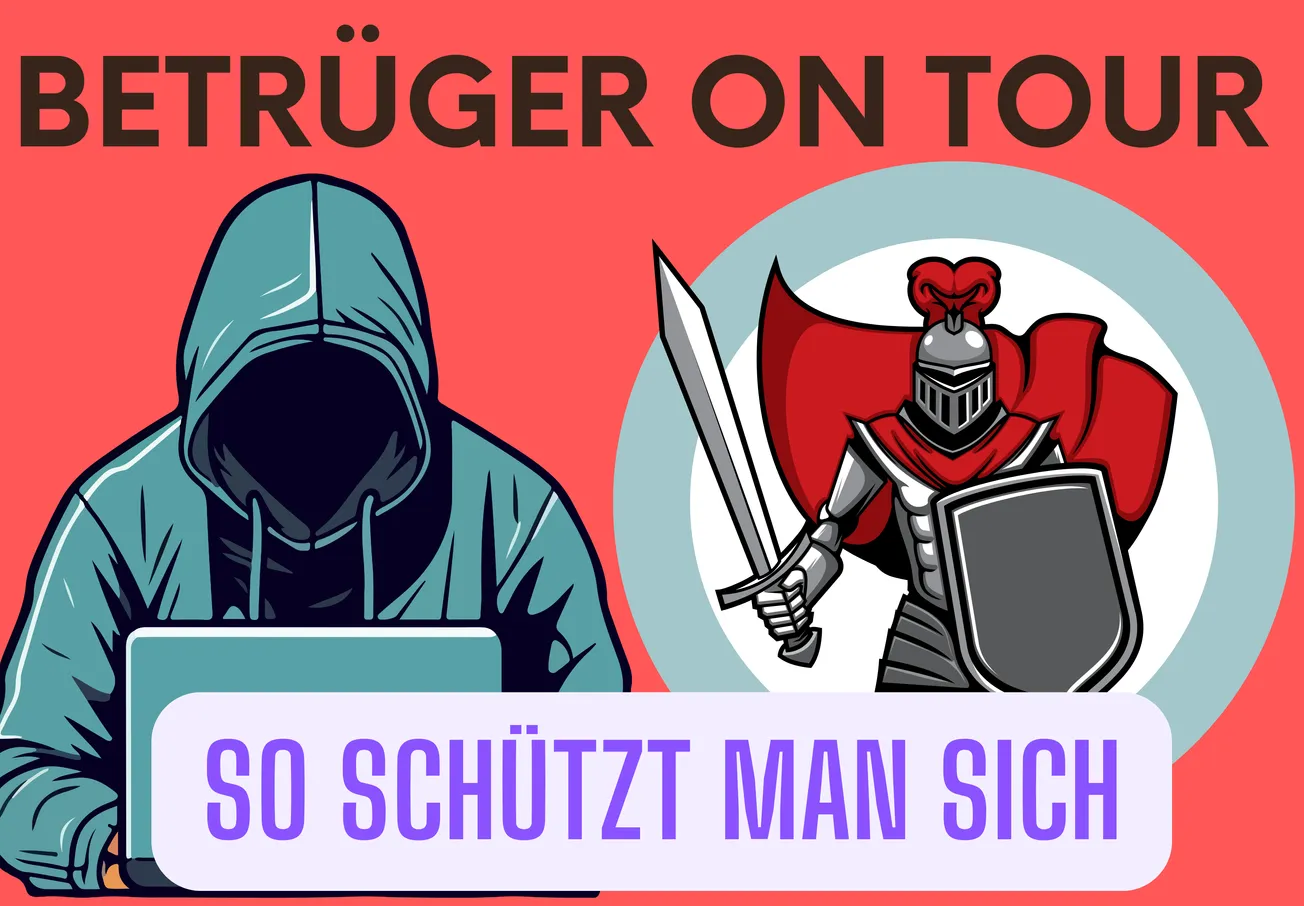Kurz gesagt: KI braucht Strom und Wasser – vor allem beim Training großer Sprachmodelle und im laufenden Betrieb. Zugleich kann sie älteren Menschen Orientierung, Entlastung und Teilhabe ermöglichen. Entscheidend ist der bewusste und effiziente Einsatz.
Warum spricht alle Welt über „KI & Nachhaltigkeit“?
Große Sprachmodelle (engl. Large Language Models, kurz LLM) wie ChatGPT beeindrucken – kosten aber Ressourcen. Der Strombedarf entsteht vor allem in Rechenzentren; der Wasserverbrauch fällt an, weil Server gekühlt werden müssen. Schon einfache Vergleiche zeigen die Dimensionen, ohne gleich zu dramatisieren.
Wo entsteht der Energiebedarf?
1) Einmalig: das Training
Das Anlernen eines großen Modells ist extrem rechenintensiv. Für GPT-3 wurde der Stromverbrauch auf rund 1,287 Millionen kWh geschätzt – etwa der Jahresverbrauch von ca. 380 Durchschnittshaushalten in Deutschland. Neuere Modelle sind komplexer, das Training bleibt aber ein einmaliger Aufwand pro Modell.
2) Laufend: die Nutzung (Inferenz)
Bei jeder Frage, die Sie an ein KI-System stellen, arbeiten Tausende Recheneinheiten. Seriöse Schätzungen liegen – je nach Szenario – zwischen etwa 4 und 9 Wh pro Anfrage; häufig zitiert wird ein Bereich um 6,9–8,9 Wh. Zum Vergleich: Eine klassische Websuche liegt bei etwa 0,3 Wh. Wichtig: Eine KI-Antwort kann inhaltlich viel umfassender sein als ein Suchtreffer.
Blick auf das große Ganze
Die Internationale Energieagentur (IEA) schätzte 2024, dass rund 15 % des Rechenzentrumsstroms bereits auf KI entfielen – Tendenz stark steigend.
Bis 2030 könnte der Rechenzentrumsbedarf auf ca. 945 TWh anwachsen (nahezu eine Verdopplung gegenüber 2024).
Das entspräche nahezu 3 % des weltweiten Stromverbrauchs und läge in etwa beim heutigen Jahresverbrauch Japans.
Und wie viel Wasser braucht KI?
Kühlung ist der Schlüssel: In vielen Rechenzentren verdunstet Wasser in Kühltürmen, um die Abwärme abzuführen.
- Training: Für GPT-3 wurden in modernen US-Rechenzentren ca. 700.000 Liter Frischwasser veranschlagt. Das Wasser „verschwindet“ nicht, es verdunstet – ist aber lokal temporär entzogen.
- Nutzung: Für ein typisches Chat-Gespräch (20–50 Fragen) werden – je nach Annahmen und Standort – bis zu rund 500 ml veranschlagt (inkl. indirektem Wasserbedarf der Stromerzeugung). OpenAI nennt 0,3 ml pro Anfragefür direktes Kühlwasser – zeigt, wie stark Methodik und Standort den Wert beeinflussen.
Einordnen: Alltägliche Vergleiche
Solche Vergleiche sind ungenau, helfen aber beim Gefühl für Größenordnungen:
- 1 KI-Anfrage ≈ 1–2 Minuten Kaffeemaschine;
- 10 Minuten Staubsaugen (≈ 0,2 kWh) ≈ ~25 KI-Anfragen;
- Autofahrt: energetisch ungefähr 20 Meter pro Person (bei 7 l/100 km, 1,5 Personen).
Gute Signale aus Europa: mehr Transparenz
Beispiel Mistral AI:
Eine Lebenszyklus-Analyse (inkl. Hardwareherstellung) weist u. a. 1,14 g CO₂e und 45 ml Wasser pro Antwort aus. Der größte Anteil an Emissionen und Wasser entfällt auf Training & Nutzung (Rechenbetrieb). Außerdem zeigt sich: Standort (Strommix, Klima, Wasserverfügbarkeit) und Modellgröße prägen die Umweltwirkung stark.
Was bedeutet das für Seniorinnen & Senioren – lohnt sich der Aufwand?
Der Nutzen im Alltag
- Leichter Zugang zu Wissen: Erklärungen in einfacher Sprache, Zusammenfassungen, Übersetzungen.
- Digitale Teilhabe: Hilfe beim Formulieren von E-Mails, beim Ausfüllen von Online-Formularen, beim Verstehen von Einstellungen am Smartphone.
- Assistenz im Alltag: Strukturierte Einkaufslisten, Rezept-Anpassungen (Unverträglichkeiten), Erinnerungen; barriereärmere Kommunikation (z. B. Diktierfunktionen).
- Sicherheit & Orientierung: Aufklärung zu Betrugsmaschen, Datenschutz-Tipps in leicht verständlicher Sprache.
Die Kosten im Blick
Der ökologische Fußabdruck ist real, aber relativierbar: Verglichen mit vielen bekannten Alltagsaktivitäten liegen KI-Anfragen nicht außerhalb dessen, was wir anderweitig oft selbstverständlich nutzen (Streaming, Autofahrten etc.).
Wichtiger ist daher die Frage: Wofür setzen wir KI ein? Wenn der gesellschaftliche Mehrwert (Selbstständigkeit, Teilhabe, Bildung) hoch ist, lässt sich der Ressourceneinsatz rechtfertigen – besonders, wenn wir sparsam & zielgerichtet nutzen.
Praktisch nachhaltig: 7 einfache Tipps für die Nutzung
- Fragen bündeln: Statt 10 Einzelfragen lieber einen gut strukturierten Prompt.
- Passende Werkzeuge wählen: Für reine Übersetzungen z. B. spezialisierte Dienste; große „Allzweck-KI“ nur, wenn nötig.
- Kürzer ist besser: „Bitte antworte kurz und klar“ reduziert Rechenaufwand.
- Offline zuerst: Notizen lokal sammeln, dann gezielt fragen.
- Zeitfenster setzen: Statt „Dauer-Chat“ gezielte Sessions (z. B. 10–15 Min.).
- Datensparsam: Keine großen Anhänge „auf Verdacht“ hochladen.
- Anbieter mit Transparenz bevorzugen: Standort, Strommix, Wassermanagement beachten.
Ein Blick nach vorn: Effizienzsprünge – und neue Technologien
- Effizientere Chips & Software: Spezialisierte KI-Chips erhöhen Leistung pro Watt; bessere Algorithmen und kleinere, spezialisierte Modelle senken den Bedarf. In der Vergangenheit stieg die Rechenleistung rasant, der Energieverbrauch weit weniger stark – Effizienzgewinne sind möglich.
- Kühlung & Wasser: Geschlossene Kühlkreisläufe, Brauch- oder aufbereitetes Abwasser statt Trinkwasser – je nach Region sinnvoll.
- Zukunftstechnologien: Quanten- und neuromorphe Ansätze könnten spezielle Aufgaben deutlich energieärmer lösen. Heute sind das Forschungsfelder – vielversprechend, aber noch nicht breit in der Alltags-KI angekommen. (Einschätzung ohne konkrete Verbrauchszahlen; Stand der Forschung ist im Fluss.)
Fazit:
Nicht verteufeln – sondern bewusst einsetzen
KI ist ressourcenhungrig, vor allem bei großskaligen Modellen. Aber: Technik, Betrieb und Nutzung werden effizienter, und wir können selbst zu einem verantwortlichen Einsatz beitragen.
Für Seniorinnen und Senioren gilt: Dort einsetzen, wo der Nutzen klar ist – beim Lernen, bei der Orientierung im Digitalen, bei Barrierefreiheit und Teilhabe. Dann ist der Aufwand gut begründet.
Glossar (einfach erklärt)
- KI / Künstliche Intelligenz: Computerprogramme, die Aufgaben erledigen, für die sonst menschliche „Intelligenz“ nötig wäre – z. B. Texte verstehen.
- LLM (Großes Sprachmodell): Eine KI, die Sprache verarbeitet/generiert (z. B. ChatGPT).
- Training: Die KI „lernt“ aus sehr vielen Beispielen – einmalig, aber energieaufwändig.
- Inferenz: Die Nutzung: Sie stellen Fragen, die KI antwortet (läuft laufend im Rechenzentrum).
- CO₂e: Einheit, die die Wirkung verschiedener Treibhausgase in CO₂-Äquivalente umrechnet.
Quellenhinweis
Dieser Beitrag basiert inhaltlich auf der BAGSO-Kurzstudie „Künstliche Intelligenz & Nachhaltigkeit – Energie- und Wasserverbrauch im Zeitalter großer Sprachmodelle“ (September 2025) und fasst zentrale Befunde verständlich zusammen. Detaillierte Zahlen und Vergleiche entnehmen Sie bitte der Originalquelle.